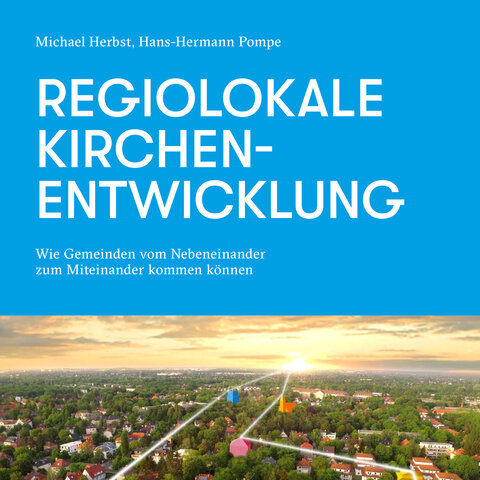Auf alle Gaben kommt es an!
Multiprofessionelle Perspektiven für die kirchliche Praxis
Die Evangelische Arbeitsstelle midi und die EKD beleuchten seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie das Thema „Agile Kirche und Diakonie: innovativ durch die Krise“ aus unterschiedlichen Perspektiven und gehen Fragen nach, die durch die Pandemie wie in einem Brennglas offensichtlich geworden sind.
In einem Erfahrungsaustausch im Dezember 2020 wurde dem Thema „Auf alle Gaben kommt es an“ nachgespürt und die Frage nach möglichen multiprofessionellen Perspektiven für die kirchliche Praxis erörtert. Der folgende Text gibt die wesentlichen Diskurslinien des Erfahrungsaustausches wieder.
Programmatisch ist es formuliert: auf alle Gaben kommt es an! Eine der Fragen, die sich stellt, ist, ob dies tatsächlich eine realistische Beschreibung und durch die kirchliche Praxis abgedeckt ist?
Mehrdeutigkeit der Begriffe
Was verstehen wir in der Kirche eigentlich unter ‚Gaben-Vielfalt‘?
Verschiedene Begriffe beschreiben eine Entwicklung der Arbeitsorganisation in Industrie, Kirche und Verwaltung: multiprofessionell, interdisziplinär, interprofessionell oder transprofessionell. Von Teams oder Gruppen wird geredet, je nach der theoretischen Schule, der man sich verpflichtet fühlt.
Gemeinsam ist allen Denk- und Handlungsansätzen, dass das Einzelkämpfertum ausgedient haben sollte. Die Komplexität der Aufgaben, die gesellschaftliche Dynamik, die technischen Entwicklungen, die Ausdifferenzierung der „Blasen“, in denen Menschen unterwegs sind, erfordert einen ebenso differenzierten Blick auf das Miteinander.
In Kirche ist die Zusammenarbeit der Verschiedenen in der theologischen DNA verankert: Ein Geist – viele Gaben. Ein Leib – viele Glieder. Unterschiedliche Charismen dienen der Erbauung der Gemeinschaft und der Menschen. Aber nicht nur im menschlichen Körper ist manches in der DNA angelegt, was sich nachher nicht ausdrückt. Auch die Entwicklung der Organisation und Institution Kirche hat nicht alle theologischen Grundlagen in Strukturen und Formen gebracht.
Hier ist der Hinweis wichtig, dass in der Geschichte der Pfarrdienst resp. das Priesteramt zur Schlüsselprofession wurde, von der andere Dienste bzw. Professionen abgeleitet sind. Trotz Reformation ist das „Priestertum aller Getauften“ in den Hintergrund getreten. Umso drängender gilt es zu schauen, wie die Zusammenarbeit der Verschiedenen, also der Charismen und Kompetenzen, Gestalt gewinnen kann, in kirchlicher Praxis.
1. Perspektive
Bedürfnislagen
Eine erste Perspektive ergibt sich, wenn die menschlichen Grundbedürfnisse in den Blick genommen werden. Sicherheit, soziale Bedürfnisse – die Wichtigkeit von gelebten Beziehungen ist in den Pandemiezeiten spürbar! – Individualbedürfnisse wie Unabhängigkeit, Freiheit, Ansehen, Selbstverwirklichung und auch Sinn bzw. Transzendenz beschreiben die Bedürfnisse aller Menschen, unabhängig von Kultur, Religion oder Milieu.
Sehen wir „Kirche“ als Akteur, dann stellt sich die Frage, welche Profession und Kompetenz hilfreich ist, um die Bedürfnisbefriedigung zu ermöglichen oder zu unterstützen. Sehen wir „Kirche“ als „Netzwerk“, in dem Beteiligung in unterschiedlichen Formen denkbar, gefördert und gewünscht ist, dann stellt sich die Frage, wie z.B. soziale und Individual-Bedürfnisse der ehren- und hauptamtlichen Akteure Gestaltungsraum bekommen.
2. Perspektive
gesellschaftliche Herausforderungen
Eine zweite Perspektive ergibt sich durch den Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen. Abgeschottete „Blasen“ von Gleichgesinnten, eine segmentierte und funktionalisierte Gesellschaft erfordern multiperspektivische und v.a. auch differenzierte Reaktionen oder Andockpunkte.
„Kirche“ hat sich in verschiedenen Organisationsformen entwickelt: Ortsgemeinden, Landeskirche, Funktionsdienste (z.B. Zielgruppenarbeit, Klinikseelsorge, Akademien, u.v.a.), die unterschiedliche Kompetenzen in der Ausgestaltung erfordern und die nicht nebeneinander oder gar gegeneinander arbeiten sollten.
Vielmehr sollte die Polyphonie der Dienste gestaltet werden als Spiegel der gesellschaftlichen Wirklichkeit und in der gegenseitigen Bereicherung der Verschiedenen. Was für Organisationsformen gilt, gilt vice versa auch für die Akteure.
3. Perspektive
Wirkmacht der Selbstverwirklichung im freiwilligen Engagement
Eine weitere Perspektive ergibt sich, wenn damit ernst gemacht wird, dass „Kirche“ keine Gegen- oder Sonderwelt ist, sondern sich als Teil der Gesellschaft begreift.
Menschen, die sich in Kirche ehren- oder hauptamtlich engagieren, werden gleichzeitig durch Engagement und Beteiligung in Vereinen, politischen Prozessen, Kultureinrichtungen, als „Familienmenschen“ inspiriert und motiviert. Sowohl das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse als auch der Bedürfnisse der Anderen und sich daran auszurichten, ist sicher ein Kitt, der unserer Gesellschaft gut tut.
Weitere Perspektiven ergeben sich, wenn die Verschiedenen sich gemeinsam in Projekten oder aufgabenorientiert auf den Weg machen. Dort bilden sich Profile der Professionen aus – nicht im Sinne der Abgrenzung und des Ausschlusses, sondern um „trittsicher“ unterwegs zu sein.
- Auf alle Gaben kommt es an: diese werden gelockt, gefordert und gefördert im Miteinander der Verschiedenen, in der multiprofessionellen Zusammenarbeit.
- Auf alle Gaben kommt es an – damit das Evangelium in allen seinen Dimensionen kommuniziert werden kann.
- Auf alle Gaben kommt es an, weil am Du das Ich wächst – und weil Charismen Erscheinungsformen der Gnade sind.
Warum multiprofessionelle Perspektiven?
Über Motivationen und Interessenlagen
An konzeptionellen Überlegungen zur Multiprofessionalität mangelt es nicht!
Schon zu Zeiten des Bundes Evangelischer Kirchen in Deutschland lag in den 1970er Jahren ein Konzept zur Multiprofessionalität vor, welches vornehmlich die unterschiedlichen Berufsgruppen im Blick hatte. Das Konzept wurde allerdings nicht konsequent umgesetzt. Ein Grund lag in der zu starken Spezialisierung, die an ihre (natürlichen) Grenzen gestoßen zu sein scheint.
Es ist deshalb naheliegend, die Bedürfnislagen zum Ausgangspunkt zu nehmen. Hier ist es unter anderem die Praxis im regionalen Raum, im Sozialraum, die multiprofessionelle Teams erforderlich macht. Multiprofessionelle Teams verstanden als Teams, die multiprofiliertes Teamwork von Ehren-, Neben- und Hauptamt ermöglichen.
Folglich ist die Frage, die konzeptionell zu beantworten ist: Welche Aufgabe ist dem professionellen Team vor diesem Hintergrund zuzuschreiben?
Gefahrenlage: Konzentration auf die Pfarrperson
Die Pfarrperson, ein für alles zuständiger Anker in der kirchlichen Praxis, hat sich überlebt. Die Vielfalt der Aufgaben in der kirchlichen Praxis, aber auch die Strukturveränderungen und damit einhergehenden Pfarrstellenreduzierungen machen eine multiprofessionelle Perspektive erforderlich, will man das volkskirchliche Programm auch in größeren Raumschaften aufrechterhalten.
Allerdings ist zu beobachten, dass anderen Professionen nicht auf Augenhöhe bei der Bewältigung dieser Aufgabe begegnet wird; nicht selten erhalten sie die Zuständigkeiten, die Pfarrpersonen für sich als nicht mehr wichtig ansehen: Multiprofessionalität als „Resterampe“. Eine an inhaltlichen Kriterien orientierte Zuschreibung fehlt vielerorts.
Umso wichtiger erscheint es, Vorstellungen, die an früheren Ämterbildern hängen, hinter sich zu lassen und sich konsequent an den Bedürfnislagen zu orientieren.
Fülle erleben statt Mangel verwalten!
Als zukunftsweisend erscheint ein ‚Konzept der Fülle statt des Mangels‘. Bei allen strukturellen Herausforderungen, den Erfahrungen des Kleiner-Werdens an Mitgliedern und des Weniger-Werdens an Pfarrpersonen, gibt es als Kontrapunkt den sozialräumlichen Erfahrungsraum des regional Größeren und durch multiprofiliertes Arbeiten das personale Mehr an Miteinander. Hier dürfte die Chiffre des „Priestertums aller Gläubigen“ und des „mündigen Christseins“ konzeptionell noch stärker zum Tragen kommen.
Multiprofessionelle Teams
Eigeninitiativ, gemeinwesenorientiert, flexibel und begleitet – aber wie?
Ausgehend davon, dass Kirche schon multiprofessionell gegründet wurde – ein Leib, viele Glieder – und durch die ehrenamtliche Leitung der Gemeinden dies zur DNA der evangelischen Kirche geworden sein müsste, dürfte sich die Frage nach der Multiprofessionalität eigentlich gar nicht stellen.
Dass sie es tut, spiegelt u.a. in eigener Weise den produktiven Konflikt zwischen Ehren- und Hauptamt in der Kirche wider bzw. dessen einseitige Lösung. Eine pfarrherrliche Kirche denkt nicht über Multiprofessionalität nach – eine Kirche die noch (bzw. nur) über Multiprofessionalität diskutiert, ist immer noch pfarrherrlich strukturiert.
Die Macht muss geteilt werden
Echte Multiprofessionalität wird geänderte Machtstrukturen in der Kirche nach sich ziehen, und das nicht nur auf Gemeindeebene.
Wenn das Evangelium sich unter die Menschen verschwenden will, dann in geistlichen, diakonischen, sozialen, ästhetischen, begleitenden, beratenden, zuhörenden und unzähligen anderen Formen.
Wenn Kirche will, dass es gehört und erlebt wird, dann muss sie genau hinschauen, was in den jeweils unterschiedlichen Sozialräumen gebraucht wird und entsprechend Teams zusammenstellen – dynamisch und flexibel bei gleichzeitiger Kontinuität.
Viele Professionen werden dann in der Ausübung der Verkündigung des Evangeliums und im Gemeindeaufbau gebraucht – auch in leitenden Funktionen.
Netzwerke entwickeln und Netzwerke nutzen
Kirche muss nicht alles selbst entwickeln, sondern kann an den Professionen im Sozialraum partizipieren. Gerade unter den Bedingungen von Einsparungen können bestimmte Professionen geteilt oder nur zeitweise beschäftigt werden.
Selbst die theologische Profession kann so partizipativ Teil der Gemeinde sein und nicht unbedingt deren Mittelpunkt. Damit gewönne man auch die Freiheit, leichter eigene Professionalitäten aufzugeben, um sie dafür über Netzwerke zurückzugewinnen ohne sie zu besitzen.
Multiprofessionelle Zusammenarbeit als Pflichtbaustein in die Ausbildung einfügen
Solche Art einer multiprofessionellen Gestalt von Kirche und Gemeinde bedeutet einen Kulturwandel. Dieser müsste bereits in der Ausbildung gefördert und erwartet werden. Die gemeinsame Ausbildung der unterschiedlichsten gemeindedienlichen Professionen wäre notwendig und ist überfällig. Die Auflösung des versäulten Arbeitens bedarf der Auflösung der versäulten Ausbildung.
Verlieren als Chance – nicht möglichst viele Mitglieder gewinnen, sondern gutes Zusammenleben vor Ort entwickeln
Ein Verständnis von Kirche als Unterstützende der Menschen vor Ort (und überall auf der Welt) zwingt sie in neue Strukturen und damit neue Berufungen.
Warum gibt es uns hier? Diese Zielfrage ist an die Menschen im Sozialraum zu stellen und deren Antwort abzuwarten. Sie ist nicht durch Kirche selbst geistlich und sozial zu beantworten, sondern von den Befragten. Diese Antworten können dann durch die Gemeinden entsprechend personell und professionell hinterlegt werden. Dabei geht es nicht um eine „Mehr“ an Arbeit, sondern ein „Stattdessen“.
Multiprofessionalität ist die Antwort für eine Kirche, die alle – wirklich alle – im Blick haben und mit ihnen gemeinsam Gemeinwesen gestalten will. Damit sie sich nicht überfordert, kann sie nur orientiert an den eigenen Gaben wirken.
Über die Diversität der Gaben und ein gutes Miteinander
Multiprofessionalität, Teamarbeit, Gabenorientierung, Partizipation – all dies sind Themen, die für die Gemeinde- und Kirchenentwicklung eine große Rolle spielen. Geht es dabei doch auch um Fragen, wie die anstehende Aufgabefülle gut bewältigt werden kann. „Das sollen wir jetzt auch noch machen?“ Diesen Satz hört man öfter in kirchlichen Zusammenhängen.
Zusammenarbeit kann weiterhelfen. Denn niemand erledigt gern und gut Aufgaben, die er nicht wirklich überblickt, von denen sie eigentlich keine Ahnung hat. Schließlich soll die Sache ja gut werden – mindestens anständig getan.
Wie kann gute Zusammenarbeit gelingen, sodass die Aufgaben wirklich gelöst werden?
Wie kann Kirche Menschen zur Mitarbeit gewinnen? Und wie kann sie ihr Personal halten? Der Team-Begriff steht hoch im Kurs, evoziert er doch lauter positive Gedanken: gute Zusammenarbeit, Kreativität, jede und jeder kann mitmachen, Gleichberechtigung und Wertschätzung und anderes auch.
Doch wer gehört überhaupt in ein Team und wer legt das fest? Sind es die verschiedenen beruflichen Professionen, wie Pfarrerin, Küster, Kita-Leitung? Meint es das Zusammenspiel in einem kirchenleitenden ehrenamtlichen Gremium oder geht es um die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen, Ehrenamtlichen mit anderen Ehrenamtlichen?
Meint es schlicht die Auffassung: die Gaben, die wir Menschen so haben, sind verschieden. Also lasst uns zusammenarbeiten – so, dass jeder das macht, was er/sie kann, weil er dafür ein besonderes Händchen hat, weil ihr Herz besonders für diese Aufgabe schlägt? Doch weil jemand z.B. digitale Verkündigung wichtig findet, bedeutet es noch nicht, dass er/sie es auch kann. Und wer entscheidet dann, wer was macht usw.
Teams brauchen Leitung, Aufgabenklärung und vor allem Vertrauen ins gemeinsame Arbeiten.
Teamentwicklung braucht Zeit und Pflege. Schon die Kultur der Zusammenarbeit kann in den verschiedenen Teams einer Kirchengemeinde oder in einem Dekanat sehr unterschiedlich sein. Und sind diese Teams Teil einer Gesamtkultur? Zusammenarbeit über die Teamgrenzen hinweg – soll dies sein? Und mit wem müsste eine Kirchengemeinde über ihre eigenen Mitarbeitenden hinaus noch kooperieren? Wieder andere Professionen und Kompetenzen kommen in den Blick.
Eine Leitfrage ist: Was ist der gemeinsame Auftrag, was leitet uns, was ist unsere Mission?
Die verschiedenen Perspektiven und Herangehensweisen kommen dann zur Wirkung, wenn sie wirklich in das Team eingespielt werden können. Es braucht also Interesse und Neugier auf den Blick des anderen. Das verursacht Reibung und Konflikte, das hält Dinge im Fluss und in Bewegung. Je diverser ein Team aufgestellt ist, desto verschiedener können die Zugänge werden, andere zur Mitarbeit zu inspirieren.
Und vielleicht braucht Kirche ganz andere Mitarbeitende als sie bereits hat – sowohl im Bereich des freiwilligen Engagements als auch in der beruflichen Arbeit.
Menschen in die Arbeit einer Gemeinde einzubinden, sie zu gewinnen, das gelingt am ehesten über die persönlich-engagierten Zugänge. Der institutionelle Zugang bewirkt hier wenig. Wer mitarbeitet, will auch Entscheidungen treffen können und dürfen und nicht lediglich Handlangerin oder Lückenbüßer sein.
Womit sich Fragen nach Partizipation und Mitbestimmung in Kirche stellen, nach Verantwortungsübernahme und Haftbarkeit. Führungs- und Leitungsbilder gibt es viele in unserer Kirche, durchaus im Widerspruch zueinander. Umgang mit Macht und Konflikten, Personalentwicklung und Personalführung – auch diese Aspekte gehören zum Themenfeld multiprofessionelles Team.
Vielleicht entstehen dann z.B. auch neue kirchliche Stellenausschreibungen, die Interesse wecken, sich zu bewerben. Denn in ihnen ist zu sehen: hier kann ich mich einbringen, hier bin ich gefragt, hier bin ich genau richtig. Und dann kann die eierlegende Wollmilchsau getrost ihrer Wege ziehen.
Multiprofiliert, sozialraumorientiert und authentisch
– auf diese Formel lässt sich ein Zukunftsbild von Multiprofessionalität bringen. Von der Einsicht geleitet, dass alle Professionen im selben Boot sitzen und mit denselben Herausforderungen in der kirchlichen Praxis konfrontiert sind, scheinen ein unverbundenes oder gar konkurrierendes Nebeneinander genauso wie ein hierarchisch der Ämterlehre geschuldetes Miteinander für die Zukunft nicht geeignet.
Als zentral für die Weiterentwicklung der multiprofessionellen Perspektiven im o.g. Sinn wird angesehen:
- Es bedarf hilfreicher Bilder zu multiprofessionellen Teams.
- Multiprofessionelle Perspektiven müssen im Stellenplan und in der Aus-, Fort- und Weiterbildung verankert werden.
- Eine Orientierung an den Lebenswelten und Sozialräumen wird als zielführend angesehen.
- Hilfreich erscheint auch eine Ist-Analyse zu bestehenden multiprofessionellen Konzepten in den Landeskirchen, um daraus gegebenenfalls Innovationen resp. Hindernisse auf dem Weg zu einer multiprofessionell ausgestalteten kirchlichen Praxis ableiten zu können.
- Multiprofessionelle Teams sollten sich trauen, den fremden Blick auf sich zuzulassen.